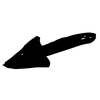Leoni
5 Tipps für eine gesunde Fehlerkultur in der Familie
Fehler zu machen bedeutet nicht, versagt zu haben - sondern, einen Schritt näher ans Ziel zu kommen. Fehler helfen uns, kreativer zu denken, dazuzulernen, und neue Fähigkeiten zu entwickeln.Kinder, die das internalisiert haben, sind oft selbstbewusster und mutiger.
Hier sind 5 Tipps, wie wir eine gesunde Fehlerkultur in der Familie fördern können.
Inhalt
- 5 Tipps für eine gesunde Fehlerkultur in der Familie
- Warum ist das wichtig?
- Fazit

Eine gesunde Fehlerkultur in der Familie fördern: So geht's
1. Fehler als Lernchance darstellen
Statt zu kritisieren oder Fehler als vermeintliche Unfähigkeit zu verurteilen, können wir den Fokus auf die Möglichkeit legen, sich weiterzuentwickeln: „Wow, das war ein interessanter Versuch! Was hast du daraus gelernt?“
2. Zu den eigenen Fehlern stehen
Wir machen selbst ständig Fehler. Im Alltag, im Job, in der Kommunikation mit unseren Kindern. Anstatt sie zu verstecken oder zu rechtfertigen, sollten wir sie klar benennen: „Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich werde versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen.”
3. Positives Feedback geben
Fehler dürfen nicht nur „korrigiert“ werden – wir sollten sie auch würdigen!Auf diese Weise lernen unsere Kinder, dass auch gescheiterte Versuche eine wertvolle Erfahrung sind. „Du hast es zwar noch nicht geschafft, aber du hast es versucht und das ist schon mal großartig!“
4. Fehler gemeinsam besprechen
Wenn z.B. Vereinbarungen oder Regeln nicht eingehalten wurden, ist es sinnvoll, mit offener Kommunikation zu reagieren. „Was ist schiefgelaufen? Kannst du benennen, warum? Was könnten wir das nächste Mal anders machen?“
5. Den Weg loben, nicht das Ziel
Wenn unsere Kinder etwas geschafft haben, tendieren wir dazu, das Endergebnis zu loben, anstatt den Prozess. Dabei ist genau das eine tolle Gelegenheit, ihnen beizubringen, auch bei Herausforderungen nicht aufzugeben:„Ich bin so stolz darauf, wie du dran geblieben bist und immer wieder neue Herangehensweisen ausprobiert hast!“
Warum ist das wichtig?
Eine gesunde Fehlerkultur in der Familie ist mehr als nur ein „pädagogisches Ideal“. Sie ist grundlegende Voraussetzung dafür, dass Kinder Selbstvertrauen entwickeln und nachhaltige Beziehungen aufbauen können.
In einer Umgebung, in der Fehler nicht sofort zu Kritik, Scham oder Strafen führen, entsteht Raum für Entwicklung. Wenn Kinder Dinge ausprobieren, daran „scheitern" und danach wieder neu anfangen dürfen, lernen sie, dass ihr Wert nicht an Leistung oder Perfektion gebunden ist.
Für uns als Eltern und Bezugspersonen bedeutet das: Fehler als natürlichen Teil eines Lernprozesses zu begreifen, bedeutet auch, Kontrolle abzugeben. Wir müssen eigene Erwartungen hinterfragen und emotionale Reaktionen regulieren.
Statt also impulsiv etwas als „falsch" oder „Fehler" zu bewerten, können wir fragen: „Was brauchst du jetzt?“ oder „Was lernen wir daraus?“ So entsteht nicht nur ein emotional sicherer Space für das Kind, sondern auch eine Atmosphäre innerhalb der Familie, in der Offenheit, Empathie und gegenseitiges Vertrauen wachsen können.
Vor allem langfristig wirkt sich eine gesunde Fehlerkultur auf das Selbstbild von Kindern aus. Denn wer früh versteht, dass Fehler nunmal dazugehören, erlebt sich selbst als handlungsfähig. Und wenn Kinder beobachten, dass auch Erwachsene sich entschuldigen oder umdenken können, lernen sie, dass es ein Zeichen von Stärke ist, Verantwortung zu übernehmen.
Fazit
Der Umgang mit Ängsten ist ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Durch empathische und unterstützende Reaktionen können Eltern ihren Kindern helfen, Ängste zu bewältigen und ein gesundes Selbstvertrauen aufzubauen. Die Validierung von Gefühlen spielt dabei eine zentrale Rolle und fördert eine offene und vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung.
Dazu passend unser Bilderbuch-Tipp: „Fehler machen ist okay" und „Hilfe brauchen ist okay" von Susann Hoffmann!